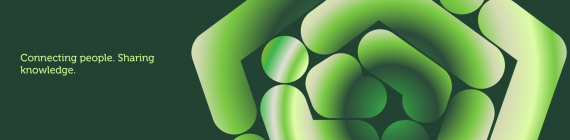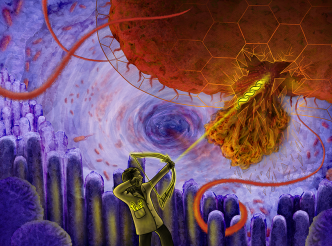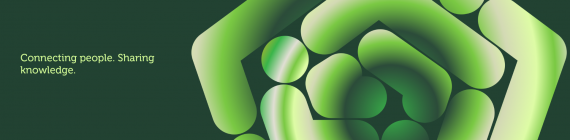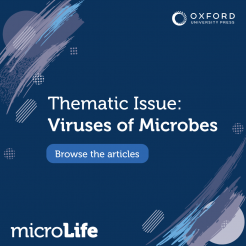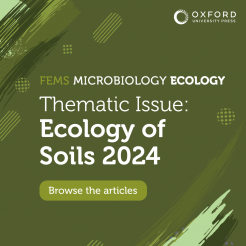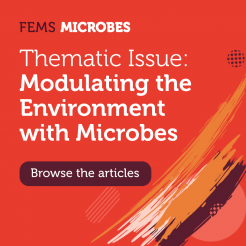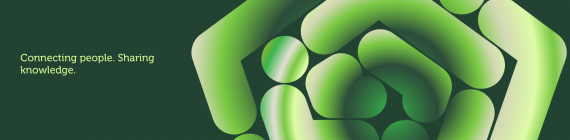Wir bedanken uns sehr herzlich bei unseren Sponsoren für die Unterstützung!


Künstliche Intelligenz für Life Sciences
Friday, 04 October 2024 07:44Verfahren wie Datenanalysen und maschinelles Lernen spielen in den Life Sciences schon seit längerer Zeit eine wesentliche Rolle, gerade auch in Österreich. Nicht zuletzt die Österreichische Gesellschaft für Molekulare Biowissenschaften und Biotechnologie (ÖGMBT) arbeitet an der Vernetzung der einschlägigen Aktivitäten.
Bereits seit etwa einem Jahrzehnt sind Bioinformatik und Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence, AI) ein zentrales Thema in der Österreichischen Gesellschaft für Molekulare Biowissenschaften und Biotechnologie (ÖGMBT). Und der Schwerpunkt liegt auf der Vernetzung der einschlägig aktiven Mitglieder, berichtet Thomas Rattei, der Stellvertretende Leiter des Departments für Mikrobiologie und Ökosystemforschung der Universität Wien, der im ÖGMBT-Vorstand für die Thematik zuständig ist. Rattei zufolge bemüht sich die ÖGMBT nicht zuletzt um den Austausch zwischen den Wissenschaftlern, die Methoden der AI entwickeln, und denen, die diese auf Forschungsfragen und Forschungsfelder anwenden. „Wir wollen als ÖGMBT Datenanalyse, maschinelles Lernen und andere Verfahren der AI in unserer Arbeit integrieren“, erläutert Rattei. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich die ÖGMBT bereits vor geraumer Zeit als eine der ersten österreichischen Forschungsgesellschaften der Thematik verschrieb. Ratteis eigene Forschungsgruppe etwa nutzt Methoden des maschinellen Lernens unter anderem, um Parameter für Vorhersagemodelle zu entwickeln und in der Folge Vorhersagen durchzuführen, nicht zuletzt, was den Phänotypus von Mikroorganismen oder das Zusammenwirken von Mikrobengemeinschaften betrifft. Bei sekretierten Proteinen werden Eigenschaften – im Bereich der AI als Features bezeichnet – erfasst, etwa die Häufigkeit von Aminosäuren sowie die Art der Faltung. Nützlich ist dies beispielsweise, um zu ermitteln, ob es sich bei einem im Abwasser aufgefundenen Mikroorganismus um einen neuen Krankheitserreger handelt, der das Gesundheitssystem vor Herausforderungen stellen könnte. Mit quantitativen Analysen wiederum befasst sich Nikolaus Fortelny, Zweigstellenleiter Nord und Vorstandsmitglied der ÖGMBT, der eine Arbeitsgruppe im Fachbereich Biowissenschaften der Paris-Lodron-Universität Salzburg leitet. Er und seine Kollegen ermitteln beispielsweise, wie viel RNA eines bestimmten Gens eine Zelle enthält, und versuchen, vom RNA-Level auf den Gehalt eines Proteins zu schließen. Auf diese Weise ist es möglich festzustellen, ob ein Patient an Krebs erkrankt ist, um welche Krebsart es sich handelt und wie weit die Krankheit fortgeschritten ist. Besondere Bedeutung legt Fortelny auf die Interpretierbarkeit der verwendeten Methoden der AI. Ihm zufolge nutzen die in der Molekularbiologie eingesetzten AI-Modelle sehr viele Parameter: „Deshalb ist es oft schwierig zu sagen, was ein Ergebnis, das uns die AI liefert, bedeutet. Aber wenn die AI etwas lernt, sollten wir auch verstehen, wie dieses Lernen funktioniert.“ Das sei nicht zuletzt eine Frage der Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit des mit A1 arbeitenden wissenschaftlichen Handelns.
Möglichkeiten und Grenzen
Eine Problematik, auf die auch Rattei hinweist. Letzten Endes gehe es um die Anwendbarkeit von Systemen der AI: „Da hilft natürlich, wenn erklärbar ist, was ein System leisten kann und was nicht.“ Nütz-lich sei stets, zwischen „Fleiß“ und „Intelligenz“ zu unterscheiden. Die AI, die mit ungeheuren Datenmengen arbeite, bringe einen „Fleiß“ auf, der den Arbeitseifer jedes Menschen zwangsläufig übersteige. Und das habe durchaus erhebliche Bedeutung im Zuge wissenschaftlicher Tätigkeit. Denn AI könne menschliche Forscher von Routinearbeiten entlasten und damit Ressourcen „für schöpferische Tätigkeiten, für die sie nach meinem Verständnis nicht geeignet ist“ frei machen. Es sei kaum vorstellbar, dass eine einschlägige Software „Alexander Fleming bei der Entwicklung des Penicillins hätte ersetzen können“. Denn sie agiere zumindest bis dato grundsätzlich innerhalb vorgegebener Regeln. Wissenschaft jedoch beschäftige sich „eben mit Bereichen, wo wir die Regeln noch nicht kennen“. Laut Fortelny besteht der „klassische“ Ansatz bei der Anwendung von AI-Programmen darin zu ermitteln, welche davon mit vielen Beispielen als Datengrundlage besser funktionieren. Der Mensch dagegen sei in der Lage, anhand weniger Beispiele Hypothesen über mögliche Zusammenhänge zu bilden – wie dies etwa Fleming bei der Entwicklung des Penicillins getan habe. Wie lange es dauern wird, bis AI über diese Art von Intelligenz verfügt und ob dies jemals der Fall sein wird, ist Fortelny zufolge kaum absehbar.
Daten-„ELIXIR“ für AI
Weil aber AI in ihren derzeitigen Formen für ihr Funktionieren auf große Datenmengen angewiesen ist, gewinnt gerade auch in der medizinischen Mikrobiologie der Austausch klinischer Daten und die dafür erforderliche Infrastruktur immer mehr an Bedeutung, betont Rattei: „Wenn jeder seine Daten in seinem Schreibtisch einsperrt, werden wir in Österreich nie zu einer vernünftigen AI kommen.“ Wichtig auf europäischer Ebene ist in dieser Hinsicht ELIXIR, eine von den Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten getragene Organisation, die Ressourcen im Bereich Life Sciences letztlich in einer einzigen Infrastruktur vernetzen soll. Österreich hat laut Rattei seit April vergangenen Jahres Beobachterstatus bei ELIXIR. Der Vollbeitritt ist für kommendes Jahr geplant. Ein wesentliches Thema bei der Datennutzung ist stets der Datenschutz. Genehmigt ein Patient die Verwendung seiner Daten für einen bestimmten Forschungszweck, dürfen diese nicht für andere Zwecke eingesetzt werden. Rattei zufolge ist das „kein Problem, sondern einfach eine der Randbedingungen, mit denen wir arbeiten“. Es gelte, Infrastrukturen zu schaffen, die die Einhaltung der datenschutzrechtli-chen Bestimmungen gewährleisten: „Sonst werden wir nie die Zustimmung der Patienten bekommen.“
Linz als „Leuchtturm“
Wie Rattei und Fortelny betonen, ist Österreich hinsichtlich Künstlicher Intelligenz im Bereich der Life Sciences im internationalen Vergleich gut positioniert. Als „Leuchtturm“ der Forschung und Entwicklung im Bereich AI gilt die Johannes-Kepler-Universität Linz. Dort entwickeln Forscher wie Günter Klambauer und Sepp Hochreiter Software, die von Biowissenschaftlern wie Rattei und Fortelny genutzt wird. Im Rahmen der „Artificial Intelligence in Life Sciences Group“ (AILS) entwickelten Hochreiter, Klambauer und ihre Kollegen unter anderem den CN.MOPS-Algorithmus, der in der Lage ist, Variationen in Genomen zu erkennen.
www.oegmbt.at
https://elixir-europe.org
https://www.jku.at/en/lit-artificial-intelligence-lab/
https://www.jku.at/en/institute-for-machine-learning/
The FEMSmicro Monthly: September
Friday, 27 September 2024 09:51As a member of the ÖGMBT you are automatically also member of the Federation of European Microbiology Societies (FEMS).
| Dear member, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Welcome to the September Edition of the FEMS Monthly Newsletter!
FEMS has had an exciting month! We launched the FEMS MICRO Milan 2025 Congress & Exhibition, welcomed new board members, celebrated International Microorganism Day, and announced the #MicrobeArt2024 contest winner. We also hosted a successful Summer School for Postdocs in Split. Immerse yourself in the world of microbiology and explore the latest discoveries and achievements in this month's newsletter.
The FEMS journals are run by microbiologists, and for microbiologists. Every article published by us has been rigorously reviewed for soundness of science by our community of academic peer reviewers – and the not-for-profit journals support the microbiology community. |
Winners of the ÖGMBT Life Scienes Awards Austria 2024
Tuesday, 29 October 2024 10:12
„Meilenstein in Bekämpfung des Klimawandels“, DNA-Veränderungen durch E-Zigaretten, Speichern von überschüssigem Strom und Krankheitsverläufe von der Wiege bis zur Bahre - Life Sciences Research Awards Austria 2024 vergeben
Wien, 18. September 2024 – Für ihre international herausragenden Arbeiten sind am Dienstag in Graz fünf junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgezeichnet worden: Die Life Sciences Research Awards Austria 2024 der Österreichischen Gesellschaft für Molekulare Biowissenschaften und Biotechnologie (ÖGMBT) gingen an Chiara Herzog von der Universität Innsbruck, Cathrine Hellerschmied (IFA Tulln) und Elma Dervic (MedUni Wien). Die Life Sciences PHD Awards Austria 2024 gingen an Francis Belén Pacheco Fiallos (IMP) und Michael Baumschabl (BOKU).
In der Kategorie Grundlagenforschung ging der Life Science Research Award 2024 an Chiara Herzog von der Universität Innsbruck (EUTOPS).
Zigaretten und E-Zigaretten verursachen DNA-Veränderungen
Zigarettenrauchen und E-Zigarettenkonsum induzieren gemeinsame DNA-Methylierungsveränderungen, die mit der Krebsentstehung verbunden sind. Das ist das Ergebnis der Forschungsarbeit von Herzog. Der Konsum ruft tiefgreifende epigenetische Veränderungen hervor, von denen angenommen wird, dass sie mit einem langfristigen Krebsrisiko verbunden sind.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38503267/
Speichern von überschüssigem Strom
Für anwendungsorientierte Forschung erhielt Cathrine Hellerschmied die Auszeichnung. Sie forscht am Institut für Umweltbiotechnologie, IFA-Tulln, Universität für Bodenkultur. Ihre Arbeit "Hydrogen storage and geo-methanation in a depleted underground hydrocarbon reservoir" wurde in der führenden Fachzeitschrift Nature Energy publiziert.
Sie beschreibt die Entwicklung eines Verfahrens, das die Speicherung von Wasserstoff in erschöpften Erdgaslagerstätten mit der Produktion von Wasserstoff aus überschüssigem Strom aus erneuerbaren Ressourcen kombiniert. Sie konnte zeigen, dass eine langfristige Speicherung von Wasserstoff möglich ist. Diese neue Technologie stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer kohlenstoffneutralen und nachhaltigen Wirtschaft dar.
https://www.nature.com/articles/s41560-024-01458-1
Krankheitsverläufe von der Wiege bis zur Bahre
Die Forscherin Elma Dervic von der MedUni Wien hat modernste Computerverfahren entwickelt, um Krankheitsverläufe der österreichischen Bevölkerung über mehr als 15 Jahre zu analysieren. Dazu hat sie umfangreiche Gesundheitsdaten (44 Millionen Datensätze) angewandt. Dabei ist es ihr gelungen, frühe Anzeichen, die auf eine bevorstehende Erkrankung hinweisen, zu identifizieren.
„Der besondere gesellschaftliche Nutzen besteht in einem verbesserten Verständnis der langfristigen Entwicklung von Krankheiten. Diese Forschung ermöglicht die Entwicklung gezielter Prognose- und Interventionsmaßnahmen, die früh ansetzen. Dadurch können Krankheitsverläufe positiv beeinflusst werden und die Gesundheitsversorgung insgesamt optimiert werden“, lautet die Begründung der Jury.
https://www.nature.com/articles/s41746-024-01015-w
Nachwuchs-Forschungspreise: Meilenstein gegen Klimawandel
Francis Belén Pacheco Fiallos vom IMP (Research Institute of Molecular Pathology, Wien) erhielt den PhD Award in der Kategorie Grundlagenforschung für die Arbeit zum Export von Boten-RNA aus dem Zellkern.
„Diese Arbeit zeichnet sich durch einen exzellenten wissenschaftlichen Zugang und durch methodische Innovation aus und besitzt das Potenzial, sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der Anwendung bedeutende Fortschritte zu erzielen“, meinte die Jury.
https://www.nature.com/articles/s41586-023-05904-0
In der Kategorie Angewandte Forschung geht der Preis an Michael Baumschabl von der BOKU Wien. Er erforschte, wie aus dünner Luft Biokunststoff wird – die Jury spricht von einem „Meilenstein in der Bekämpfung des Klimawandels“. Indem er eine Hefeart genetisch so modifiziert hat, dass sie Kohlendioxid in wertvolle Produkte umwandelt, habe Baumschabl eine Tür zu einer nachhaltigeren Zukunft aufgestoßen.
https://forschung.boku.ac.at/en/publications/184405
Die drei Life Sciences Research Awards wurden auch 2024 wieder vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft gesponsert. Arbeits- und Wirtschaftsminister Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher: Die Life Sciences Research Awards fördern junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – eine Initiative, die dazu beiträgt, den Forschungsstandort Österreich weiter auszubauen. Denn Forschung und Entwicklung sind Schlüsselfaktoren für Österreich im internationalen Wettbewerb und tragen dazu bei, hochwertige Arbeitsplätze zu sichern und zu generieren. Mit einer voraussichtlichen Forschungsquote von 3,34 Prozent, also dem Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben am nominellen Bruttoinlandsprodukt, ist Österreich auf einem guten Weg Platz 1 in Europa zu werden und als Forschungsnation zu den vier Innovationsleader aufzusteigen.“
ÖGMBT-Jahrestagung ist Österreichs bedeutendster Life-Sciences-Event
Die ÖGMBT repräsentiert 1.300 in den Life Sciences tätige Personen und Studierende sowie 90 Unternehmen und Institutionen. ÖGMBT-Präsidentin Univ.-Prof. Dr. Viktoria Weber bei der Jahresversammlung, die diesmal in Graz stattfand: „Einmal mehr zeigen die Life Sciences Research Awards Austria das hohe internationale Niveau der Forscherinnen und Forscher in Österreich. Ich bedanke mich in Namen der ÖGMBT ganz besonders bei unserem langjährigen Unterstützer BMAW sowie THP Medical Products und Polymun Scientific, die diese Auszeichnungen ermöglichen.“
FOTO: ÖGMBT
Ausgezeichnet: Chiara Herzog, Cathrine Hellerschmied, Michael Baumschabl, Francis Belén Pacheco Fiallos und Elma Dervic.
Special thanks to the sponsor who make these prizes possible!

The FEMSmicro Monthly: August
Thursday, 29 August 2024 09:52As a member of the ÖGMBT you are automatically also member of the Federation of European Microbiology Societies (FEMS).
| Dear member, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
August has been an exciting month for the microbiology community!
Our top Editor's choice journals continue to deliver groundbreaking research, while our blog explores recent discoveries on urinary tract infections, microbial interactions within honey bee hives, and innovative strategies for combating pathogens using sugar transporters. In addition to our rich content, we are delighted to announce the new Section Editor of the FEMS Microbiology Letters Pathogens & Pathogenicity section. Furthermore, we invite all creative minds to participate in the International Microorganism Day Microbe Art Contest. Let your imagination flow as you explore the artistic potential of microorganisms. We can't wait to see your unique interpretations of the microbial world.
All the best,
The FEMS journals are run by microbiologists, and for microbiologists. Every article published by us has been rigorously reviewed for soundness of science by our community of academic peer reviewers – and the not-for-profit journals support the microbiology community.
|
Studium absolviert, was nun?
Thursday, 08 August 2024 08:43Die Life Sciences Career Fair hat sich als führende österreichische Karriereplattform der Branche etabliert. Mit dem, was sie dabei kennenlernten, zeigten sich die Teilnehmer zufrieden.
2022 war es noch ein zarter Versuch: Am Vortag der ÖGMBT-Jahrestagung im neueröffneten Biologiezentrum der Universität Wien startete damals der Pilot einer eigenen Karrieremesse für die Life-Sciences-Branche. Vergangenes Jahr emanzipierte sich die „Life Sciences Career Fair“ (LSCF) bereits als eigene Veranstaltung, die Arbeitgeber mit jungen Talenten zusammenbrachte. Heuer ging das Format nun endgültig in Serie – und konnte den Erfolg der letzten Ausgabe wiederholen: 22 Aussteller waren mit eigenem Auftritt vertreten, 540 Teilnehmer informierten sich über Jobangebote, die meisten von ihnen in der Endphase eines Master- oder Doktoratsstudiums. Innerhalb Österreichs lag der Schwerpunkt verständlicherweise auf dem Raum Wien. Beachtlich ist, dass 9 Prozent eigens aus Nachbarländern zur LSCF angereist sind.Die Teilnehmer bekamen denn auch einiges geboten: Neben dem persönlichen Austausch mit potenziellen Arbeitgebern und Anbietern von Weiterbildungsangeboten an den Ausstellungsständen gab es Workshops zu Prioritätensetzungen bei Karriereentscheidungen (Claudia Weber, psychosoziale Beraterin; Petra Buchinger, Coach und Organisationsentwicklerin), zur Positionierung des eigenen Profils auf Linkedin (Talentor Austria) sowie zum Verfassen von CVs und Bewerbungsschreiben (Life Science Karriere Services). Para-minder Dhillon von der Fachzeitschrift PLOS One stellte vor, wie eine Karriere im Scientific Publishing aussehen könnte, Boehringer Ingelheim zeigte in einer ausführlichen „Employer Presentation“ die Karriere-Möglichkeiten am Standort Wien auf. Die Aussteller erhielten auch die Gelegenheit, sich gleich nach der Eröffnung der Veranstaltung in zweiminütigen Kurzpräsentationen darzustellen – und viele nahmen das gerne an: Vom Startup bis zum Großkonzern, vom Doktoratskolleg bis zum Planungsbüro.
Karrieremöglichkeiten, an die man vorher gar nicht gedacht hat
Erneut war die FH Campus Wien an ihrem Standort in Wien 10 Gastgeber der Veranstaltung. Evelin Süss-Stepancik (Vizerektorin für akademische und internationale Angelegenheiten) und Bea Kuen-Krismer (Leiterin des Departments Applied Life Sciences), begrüßten die Anwesenden und stellten die mit den technischen Fortschritten der vergangenen Jahrzehnte schritthaltenden Ausbildungswege (man denke etwa an die biotechnologische Prozessentwicklung) dem Bedarf an Fachkräften aus diesem Bereich gegenüber. „Die Life Science Career Fair ist eine gute Gelegenheit zum Netzwerken“, motivierte Kuen-Krismer Teilnehmer und Aussteller. Ulrike Unterer, Leiterin der Abteilung für Schlüsseltechnologien im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW), das die Karriereplattform von Anfang an unterstützte, hatte ihren Mitarbeiter Hermann Heinrich mitgebracht, der anhand aktueller Zahlen die Dynamik des österreichischen Life-Sciences-Sektors vor Augen führte. Das Ministerium hat bei der Förderung des Austauschs zwischen Wissenschaft und Wirtschaft eine klare Zielrichtung: „Uns ist es wichtig, dass Sie hier in Österreich einen Job finden“, so Heinrich. ÖGMBT-Präsidentin Viktoria Weber fand in ihren Ausführungen vor allem Worte des Dankes: Für die FH als Gastgeberin, das BMAW als Unterstützer, das ACIB als Partner – und das ÖGMBT-eigene Office, das mit viel Engagement ein solches Event auf die Beine gestellt hat. Eine eindrucksvolle Bilanz ergab eine von ÖGMBT-Geschäftsführerin Alexandra Khassidov durchgeführte Online-Umfrage im Nachgang der Veranstaltung: Rund 70 Prozent der Teilnehmer haben angegeben, dass sie bei der LSCF den Arbeitgeber gefunden hätten, für den Sie gerne arbeiten würden. Und ca. 45 Prozent haben für sich Karriere-Optionen entdeckt, an die sie vorher nicht gedacht hatten.
The FEMSmicro Monthly: June
Friday, 05 July 2024 09:04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The FEMS journals are run by microbiologists, and for microbiologists. Every article published by us has been rigorously reviewed for soundness of science by our community of academic peer reviewers – and the not-for-profit journals support the microbiology community.
OECD „Co-operative Research Programme: Sustainable Agricultural and Food
Friday, 28 June 2024 08:48http://www.oecd.org/agriculture/crp/
Dieses OECD Forschungsförderungsprogramm wird durch das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gefördert.
Haben Sie vor 2025 eine internationale hybride, virtuelle oder Präsenz- Veranstaltung (Workshop, Konferenz, Kongress, etc.) zu aktuellen Forschungsthemen in den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittel, Fischerei oder Wald zu organisieren?
Oder möchten Sie Ihr Forschungsprojekt im Ausland durchführen und dadurch internationale Netzwerke aufbauen?
In diesem Fall empfehlen wir Ihnen eine Finanzierung durch dieses OECD-Forschungsförderungs-Programm zu beantragen.
Die Forschungsfelder sind breit gestreut, so sind Förderungen zum Beispiel für die Arbeit in folgenden Bereichen möglich:
- Nachhaltiges Produktivitätswachstum, Lebensmittelsicherheit und Ernährung;
- Eindämmung des Klimawandels; Verringerung der Emissionen aus der Landwirtschaft und den Lebensmittelsystemen, Kohlenstoffbindung in der Land- und Forstwirtschaft sowie der Landnutzung;
- Verringerung der negativen Umweltauswirkungen der Tierhaltung und der für die Tiergesundheit und das Wohlergehen der Tiere schädlichen Praktiken; Untersuchung des positiven Beitrags, den die Tierhaltung zur Bodenqualität und -bewirtschaftung, zur biologischen Vielfalt und zur Sicherung des Lebensunterhalts leisten kann;
- Biologische Vielfalt, Verbesserung der Ökosystemleistungen;
- Eindämmung und Umkehrung des Waldverlustes und der Bondendegradation;
- Verbesserung der Bodengesundheit sowie der Wasser- und Luftqualität, auch durch agrarökologische und andere innovative, kontextspezifische Ansätze;
- Innovationen bei der Weitergabe und Entwicklung von landwirtschaftlichem Wissen, einschließlich indigenem und traditionellem Wissen;
- Produktivität, Nachhaltigkeit und Resilienz von Fischerei und Aquakultur;
Das Programm gliedert sich in folgende drei Themen:
- Managing Natural Capital
- Strengthening Resilience in the Face of Multiple Risks in a Connected World
- Transformational Technologies and Innovation
Broschüre zum OECD-Programm: http://www.oecd.org/agriculture/crp/documents/oecd-cooperative-research-programme-brochure-.pdf
International Events Sponsorship Campaign 2025
Ein Schwerpunkt dieses OECD-Programms ist die finanzielle Förderung von internationalen Veranstaltungen (Workshop, Konferenz, Kongress, etc.). Ein Antrag kann für eine hybride, virtuelle oder Präsenz- Veranstaltung gestellt werden. Interessierte Forscher:innen bzw. Institutionen können sich ab sofort bei der OECD bewerben.
Dafür steht ein Online Antragsformular inklusive Hilfe zum Ausfüllen zur Verfügung.
Es wird dringend empfohlen sich vor der Einreichung des Antrags direkt mit dem zuständigen Mitglied des „Scientific Advisory Body“ in Verbindung zu setzen.
Weitere Informationen über die einzuhaltenden Guidelines & Conditions finden Sie nachstehend: https://www.oecd.org/agriculture/crp/documents/crp-conference-application-guidelines-and-conditions.pdf
Deadline für die Einreichung von Anträgen zur Finanzierung von internationalen Veranstaltungen für das Jahr 2025 ist der 10. September 2024.
Fellowship Campaign 2025
Interessierte Forscher:innen können sich um das Sponsoring von Auslandsaufenthalten (Dauer: 6 bis 26 Wochen) in den teilnehmenden OECD-Mitgliedstaaten bewerben.
Dafür steht ein Online Antragsformular inklusive Hilfe zum Ausfüllen zur Verfügung.
Es wird dringend empfohlen sich vor der Einreichung des Antrags direkt mit dem zuständigen Mitglied des „Scientific Advisory Body“ in Verbindung zu setzen.
Weitere Informationen über die einzuhaltenden Guidelines & Conditions finden Sie nachstehend: https://www.oecd.org/agriculture/crp/documents/crp-fellowship-guidelines.pdf
Deadline für die Einreichung von Anträgen zur Finanzierung von Auslandsaufenthalten für das Jahr 2025 ist der 10. September 2024.
Teilnahmeberechtigt sind Forscher:innen bzw. Institutionen all jener OECD-Mitgliedstaaten, die sich am Programm beteiligen.
Für weitere Informationen steht das Programmsekretariat unter This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. zur Verfügung.
Extrazelluläre Vesikel für Diagnostik und Therapie
Wednesday, 12 June 2024 09:23Die nanometergroßen „Bläschen“ zum Transport von Molekülen zwischen Zellen werden derzeit in aller Welt intensiv beforscht. Österreichische Einrichtungen sind vorne mit dabei, auch mit Unterstützung der Fachgesellschaften ASEV und ÖGMBT.
Extrazelluläre Vesikel (EV) für diagnostische und therapeutische Zwecke zu nutzen, ist derzeit Gegenstand umfangreicher weltweiter Aktivitäten in der biomedizinischen Forschung und Entwicklung. Die Vesikel, „Bläschen“ mit einer Größe im Nanometerbereich, werden von Zellen aller Art abgesondert. An ihrer Oberfläche, aber auch in ihrem Inneren, tragen sie Biomoleküle, die sie an andere Zellen weitergeben. Das könnte bei der Diagnostizierung von Erkrankungen ebenso hilfreich sein wie bei der zielgenauen Verabreichung von Arzneimitteln. Und gerade Österreich hat diesbezüglich viel aufzuweisen, berichtet der Präsident der Austrian Society for Extracellular Vesicles (ASEV), Wolfgang Holnthoner. Ihm und Johannes Grillari, Direktor am Wiener Ludwig-Boltzmann-Institut (LBI) für Traumatologie der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft, gelang es, den Jahreskongress 2025 der ISEV, der internationalen Dachgesellschaft der nationalen Gesellschaften zur Beforschung der EV, nach Wien zu bringen. Stattfinden wird dieser vom 23. bis 25. April 2025 in der Messe Wien. Die Kongress-Leitung übernehmen Eva Rohde, leitende Transfusionsmedizinerin am Universitätsklinikum Salzburg, die sich seit 2012 mit der Entwicklung und klinischen Testung von Nanovesikulären Therapien beschäftigt, und Eva-Maria Krämer-Albers, Neurowissenschaftlerin an der Gutenberg-Universität in Mainz. Laut Holnthoner werden etwa 1.500 Teilnehmer erwartet: „Das dürfte das bisher größte derartige Meeting werden.“ Beim heurigen ISEV-Kongress in Melbourne kamen 1.000 Fachleute zusammen. Und die australischen Kollegen legten einiges vor, schildert Holnthoner: „Das war ein supertoller Kongress.“ Aber auch die Veranstaltung in Wien werde mancherlei zu bieten haben.Zuvor aber treffen einander die Mitglieder der ASEV am 16. und 17. September 2024 an der Medizinischen Universität Wien zu ihrem Jahreskongress. Dieser wird gemeinsam mit der tschechischen EV-Gesellschaft CzeSEV abgehalten. Laut Holnthoner geht es darum, einen Überblick über die einschlägigen Aktivitäten in beiden Ländern zu bieten. Allein in Wien befassen sich fünf Einrichtungen mit EV. „Außerdem sind in Salzburg, Linz, Krems und Graz Kollegen tätig. Wir wissen kaum noch, wer welche Themen beforscht und welche Techniken nutzt.“ Was sich in Tschechien tue, sei ebenfalls weitgehend unbekannt. Als Keynote-Speaker beim ASEV-CzeSEV-Kongress fungieren internationale Fachleute, namentlich Marca Wauben von der Universität Utrecht, Alireza Fazeli von der Universität Tartu in Estland, Carlos Salomon von der University of Queensland in Australien und Samir El-Andaloussi vom Karolinska Institute in Stockholm. Als Sponsoren fungieren Beckman Coulter, EVScale, CYTEK, ONI, Eppendorf, IZON, Particle Metrix, Unchained Labs und Bartelt.
Forschen in Salzburg
Anfang 2024 nahm an der Paris-Lodron-Universität-Salzburg (PLUS) das Institut für Nanovesikuläre Präzisionsmedizin der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft (LBG) seine Tätigkeit auf. Geleitet wird es von Nicole Meisner-Kober, die über 20 Jahre Erfahrung in der industriellen Wirkstoffforschung verfügt. Im Zuge ihrer seinerzeitigen Arbeiten an neuen Wirkstoffen auf RNA-Basis befasste sich Meisner-Kober damit, dass extrazelluläre Vesikel ein körpereigenes Transportsystem bilden, das „auf schonende und effektive Art und Weise Moleküle in unserem Körper zielgerichtet zwischen den Zellen transportiert“. Da es sich bei den Vesikeln um körpereigene Partikel handelt, greift das Immunsystem sie nicht an. Ferner können sie Barrieren wie die Blut-Hirn-Schranke durchdringen.Im Rahmen des neuen Instituts untersuchen Meisner-Kober und ihr Team in drei Programmlinien das auf den EV basierende Transportsystem und seine Fähigkeiten, um diese für die Verabreichung von Wirkstoffen zu nutzen. Eine vierte Programmlinie, geleitet von Eva Rohde von der Paracelsus-Universität Salzburg, befasst sich unter anderem mit regulatorischen Fragen, der Schnittstelle zur klinischen Praxis sowie der Einbindung von Patienten. Als Indikationen haben Meisner-Kober und ihre Kollegen vor allem Krebserkrankungen sowie neurodegenerative Krankheiten im Blick: „Naheliegend ist die Anwendung von EV bei Krebstherapien, weil hier ein zielgerichteter Transport einen Durchbruch ermöglichen könnte. So ließe sich der Tumor bekämpfen, ohne das umliegende Gewebe zu schädigen. Bei Arzneimitteln gegen neurodegenerative Erkrankungen wiederum können wir mit den Vesikeln die Blut-Hirn-Schranke überwinden.“ Als medizinisch sinnvoll könnte es sich ihr zufolge erweisen, außer neuen Wirkstoffen bewährte Substanzen exakter einzusetzen. Im Zuge seiner Forschungen beschäftigt sich das Team des Instituts mit Vesikeln aus unterschiedlichen Quellen, um herauszufinden, welche davon für welche Zwecke am besten geeignet sind. Vesikel aus Milch etwa werden vom Organismus gut aufgenommen und ließen sich deshalb möglicherweise für die orale Verabreichung von Wirkstoffen nutzen – laut Meisner-Kober die „Königsdisziplin“ bei der Gabe von Arzneimitteln. Dazu kommt: Milch sowie bei ihrer Verarbeitung entstehende Neben- und Abfallprodukte stehen in großen Men-gen zur Verfügung und sind daher für die Gewinnung der Vesikel attraktiv. Vesikel aus menschlichen Stammzellen und deren inhärent entzündungshemmende und regenerationsfördernde Eigenschaften sollen außerdem in einer der Programmlinien, unter Leitung von Mario Gimona, für Gewebereparatur nach akuten oder chronischen Schädigungen genutzt werden. Vorteilhaft ist die Arbeit im Rahmen eines Ludwig-Boltzmann-Instituts laut Meisner-Kober, weil sich dabei über einen Zeitraum von zehn Jahren die Grundlagenforschung mit anwendungsorientierten Schwerpunkten verbinden lässt: „Wir hoffen, innerhalb der Laufzeit des Instituts unter dem Schirm der LBG die ersten Anwendungen unserer Forschungsarbeit zu sehen.“ Angestrebt wird, das Institut nach dem Auslaufen der 15 Millionen Euro umfassenden Förderung durch die LBG weiterzuführen, etwa als COMET-Zentrum.
Doktoratsprogramm in Krems
Unterdessen laufen an der Donau-Universität Krems die Vorbereitungen für das Doktoratsprogramm „EVision: Extracellular Vesicles in Inflammation“. Dieses
wurde Ende 2023 vom Wissenschaftsfonds FWF bewilligt und ist mit 1,2 Millionen Euro dotiert, berichtet die Programmkoordinatorin und Vizerektorin der Universität, Viktoria Weber. Ihr zufolge handelt es sich um ein „doc.funds.connect-Programm“, bei dem eine Universität und eine Fachhochschule (FH) zusammenarbeiten. Das ermöglicht Masterstudenten an der FH, ihre Ausbildung mit einer Promotion abzuschließen. An EVision ist als dritter Partner die MedUni Wien beteiligt. Mit den FWF-Mitteln können die Personalkosten von fünf Doktoranden sowie ein Teil des Aufwands für Labormaterialien und Auslandsaufenthalte vier Jahre lang gedeckt werden. Vorgesehen sind drei- bis fünfmonatige Tätigkeiten der Doktoranden bei führenden Forschungsgruppen in Deutschland, Italien, Ungarn und Kanada. Das Programm beginnt mit Anfang des neuen Studienjahres im Oktober. Inhaltlich geht es bei EVision um die Rolle extrazellulärer Vesikel, die im Blut vorkommen, bei Entzündungsprozessen sowie bei der Blutgerinnung. Diese beiden Vorgänge sind laut Weber „immer sehr stark verbunden. Bei jeder Entzündung wird auch die Gerinnung aktiviert. So soll verhindert werden, dass sich eine Infektion weiter ausbreitet“. Allerdings kann die gleichzeitige Akti-vierung der Entzündung und der Gerinnung, bekannt als Immunothrombose, zu schweren Schädigungen des Organismus und schlimmstenfalls zum Tod führen. Der Grund ist Weber zufolge die Bildung kleinster Blutgerinnsel in den Kapillargefäßen, die den Blutfluss in die Organe behindert, diese schädigt und im Extremfall den Tod durch Multiorganversagen auslöst. Im Rahmen von EVision befassen sich die Doktoranden insbesondere mit Vesikeln, die in Blutprodukten enthalten sind. Während der Lagerung dieser Blutprodukte steigt die Anzahl der in ihnen vorhandenen Vesikel. Untersucht werden soll bei EVision unter anderem, ob diese Vesikel bei einer Verabreichung des Blutprodukts nachteilig wirken können. „Tumor-patienten etwa haben häufig schon eine voraktivierte Gerinnung. Verabreicht man ihnen ein Blutprodukt, das sehr viele Vesikel enthält, könnte das Effekte hervorrufen“, erläutert Weber. Deshalb sollten an Krebs Erkrankte eher mit frischen Blutprodukten behandelt werden. In Bezug auf Entzündungen wiederum deuten manche Studien darauf hin, dass Vesikel diese einerseits auslösen, andererseits aber auch eindämmen können. Auch mit diesen Phänomenen werden sich die Doktoranden im Zuge von EVision befassen.
Interaktion der Fachgesellschaften
Die breite Aufmerksamkeit, die das Thema „extrazelluläre Vesikel“ im Life-Science-Sektor findet, zeigt sich auch im Interagieren der ASEV mit der Österreichischen Gesellschaft für Molekulare Biowissenschaften und Biotechnologie (ÖGMBT). Laut Weber, die gemeinsam mit Andreas Spittler die ASEV gründete und derzeit der ÖGMBT präsidiert, waren bei Kongressen der ÖGMBT bereits mehrfach Vorträge und ganze Sessions dieser Thematik gewidmet. Ihr zufolge ziehen die beiden Gesellschaften an einem Strang, „einerseits, um junge Forschende für extrazelluläre Vesikel zu interessieren und andererseits in diesem Bereich tätige Personen sowie Institutionen noch besser zu vernetzen“. Die ÖGMBT hat laut Weber viele Firmenmitglieder und ist eine „sehr aktive Plattform für die Verbindung von Forschenden und Firmen“.
www.asev.at/annualmeeting
https://nvpm.lbg.ac.at
www.donau-uni.ac.at/de/universitaet
www.oegmbt.at
www.isev.org/isev2025
Published in Chemiereport 03/2024