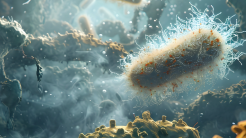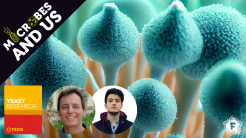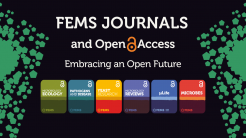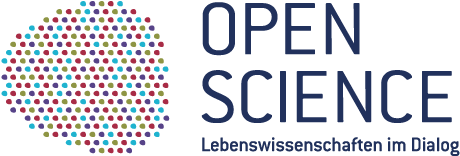Die nanometergroßen „Bläschen“ zum Transport von Molekülen zwischen Zellen werden derzeit in aller Welt intensiv beforscht. Österreichische Einrichtungen sind vorne mit dabei, auch mit Unterstützung der Fachgesellschaften ASEV und ÖGMBT.
Extrazelluläre Vesikel (EV) für diagnostische und therapeutische Zwecke zu nutzen, ist derzeit Gegenstand umfangreicher weltweiter Aktivitäten in der biomedizinischen Forschung und Entwicklung. Die Vesikel, „Bläschen“ mit einer Größe im Nanometerbereich, werden von Zellen aller Art abgesondert. An ihrer Oberfläche, aber auch in ihrem Inneren, tragen sie Biomoleküle, die sie an andere Zellen weitergeben. Das könnte bei der Diagnostizierung von Erkrankungen ebenso hilfreich sein wie bei der zielgenauen Verabreichung von Arzneimitteln. Und gerade Österreich hat diesbezüglich viel aufzuweisen, berichtet der Präsident der Austrian Society for Extracellular Vesicles (ASEV), Wolfgang Holnthoner. Ihm und Johannes Grillari, Direktor am Wiener Ludwig-Boltzmann-Institut (LBI) für Traumatologie der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft, gelang es, den Jahreskongress 2025 der ISEV, der internationalen Dachgesellschaft der nationalen Gesellschaften zur Beforschung der EV, nach Wien zu bringen. Stattfinden wird dieser vom 23. bis 25. April 2025 in der Messe Wien. Die Kongress-Leitung übernehmen Eva Rohde, leitende Transfusionsmedizinerin am Universitätsklinikum Salzburg, die sich seit 2012 mit der Entwicklung und klinischen Testung von Nanovesikulären Therapien beschäftigt, und Eva-Maria Krämer-Albers, Neurowissenschaftlerin an der Gutenberg-Universität in Mainz. Laut Holnthoner werden etwa 1.500 Teilnehmer erwartet: „Das dürfte das bisher größte derartige Meeting werden.“ Beim heurigen ISEV-Kongress in Melbourne kamen 1.000 Fachleute zusammen. Und die australischen Kollegen legten einiges vor, schildert Holnthoner: „Das war ein supertoller Kongress.“ Aber auch die Veranstaltung in Wien werde mancherlei zu bieten haben.Zuvor aber treffen einander die Mitglieder der ASEV am 16. und 17. September 2024 an der Medizinischen Universität Wien zu ihrem Jahreskongress. Dieser wird gemeinsam mit der tschechischen EV-Gesellschaft CzeSEV abgehalten. Laut Holnthoner geht es darum, einen Überblick über die einschlägigen Aktivitäten in beiden Ländern zu bieten. Allein in Wien befassen sich fünf Einrichtungen mit EV. „Außerdem sind in Salzburg, Linz, Krems und Graz Kollegen tätig. Wir wissen kaum noch, wer welche Themen beforscht und welche Techniken nutzt.“ Was sich in Tschechien tue, sei ebenfalls weitgehend unbekannt. Als Keynote-Speaker beim ASEV-CzeSEV-Kongress fungieren internationale Fachleute, namentlich Marca Wauben von der Universität Utrecht, Alireza Fazeli von der Universität Tartu in Estland, Carlos Salomon von der University of Queensland in Australien und Samir El-Andaloussi vom Karolinska Institute in Stockholm. Als Sponsoren fungieren Beckman Coulter, EVScale, CYTEK, ONI, Eppendorf, IZON, Particle Metrix, Unchained Labs und Bartelt.
Forschen in Salzburg
Anfang 2024 nahm an der Paris-Lodron-Universität-Salzburg (PLUS) das Institut für Nanovesikuläre Präzisionsmedizin der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft (LBG) seine Tätigkeit auf. Geleitet wird es von Nicole Meisner-Kober, die über 20 Jahre Erfahrung in der industriellen Wirkstoffforschung verfügt. Im Zuge ihrer seinerzeitigen Arbeiten an neuen Wirkstoffen auf RNA-Basis befasste sich Meisner-Kober damit, dass extrazelluläre Vesikel ein körpereigenes Transportsystem bilden, das „auf schonende und effektive Art und Weise Moleküle in unserem Körper zielgerichtet zwischen den Zellen transportiert“. Da es sich bei den Vesikeln um körpereigene Partikel handelt, greift das Immunsystem sie nicht an. Ferner können sie Barrieren wie die Blut-Hirn-Schranke durchdringen.Im Rahmen des neuen Instituts untersuchen Meisner-Kober und ihr Team in drei Programmlinien das auf den EV basierende Transportsystem und seine Fähigkeiten, um diese für die Verabreichung von Wirkstoffen zu nutzen. Eine vierte Programmlinie, geleitet von Eva Rohde von der Paracelsus-Universität Salzburg, befasst sich unter anderem mit regulatorischen Fragen, der Schnittstelle zur klinischen Praxis sowie der Einbindung von Patienten. Als Indikationen haben Meisner-Kober und ihre Kollegen vor allem Krebserkrankungen sowie neurodegenerative Krankheiten im Blick: „Naheliegend ist die Anwendung von EV bei Krebstherapien, weil hier ein zielgerichteter Transport einen Durchbruch ermöglichen könnte. So ließe sich der Tumor bekämpfen, ohne das umliegende Gewebe zu schädigen. Bei Arzneimitteln gegen neurodegenerative Erkrankungen wiederum können wir mit den Vesikeln die Blut-Hirn-Schranke überwinden.“ Als medizinisch sinnvoll könnte es sich ihr zufolge erweisen, außer neuen Wirkstoffen bewährte Substanzen exakter einzusetzen. Im Zuge seiner Forschungen beschäftigt sich das Team des Instituts mit Vesikeln aus unterschiedlichen Quellen, um herauszufinden, welche davon für welche Zwecke am besten geeignet sind. Vesikel aus Milch etwa werden vom Organismus gut aufgenommen und ließen sich deshalb möglicherweise für die orale Verabreichung von Wirkstoffen nutzen – laut Meisner-Kober die „Königsdisziplin“ bei der Gabe von Arzneimitteln. Dazu kommt: Milch sowie bei ihrer Verarbeitung entstehende Neben- und Abfallprodukte stehen in großen Men-gen zur Verfügung und sind daher für die Gewinnung der Vesikel attraktiv. Vesikel aus menschlichen Stammzellen und deren inhärent entzündungshemmende und regenerationsfördernde Eigenschaften sollen außerdem in einer der Programmlinien, unter Leitung von Mario Gimona, für Gewebereparatur nach akuten oder chronischen Schädigungen genutzt werden. Vorteilhaft ist die Arbeit im Rahmen eines Ludwig-Boltzmann-Instituts laut Meisner-Kober, weil sich dabei über einen Zeitraum von zehn Jahren die Grundlagenforschung mit anwendungsorientierten Schwerpunkten verbinden lässt: „Wir hoffen, innerhalb der Laufzeit des Instituts unter dem Schirm der LBG die ersten Anwendungen unserer Forschungsarbeit zu sehen.“ Angestrebt wird, das Institut nach dem Auslaufen der 15 Millionen Euro umfassenden Förderung durch die LBG weiterzuführen, etwa als COMET-Zentrum.
Doktoratsprogramm in Krems
Unterdessen laufen an der Donau-Universität Krems die Vorbereitungen für das Doktoratsprogramm „EVision: Extracellular Vesicles in Inflammation“. Dieses
wurde Ende 2023 vom Wissenschaftsfonds FWF bewilligt und ist mit 1,2 Millionen Euro dotiert, berichtet die Programmkoordinatorin und Vizerektorin der Universität, Viktoria Weber. Ihr zufolge handelt es sich um ein „doc.funds.connect-Programm“, bei dem eine Universität und eine Fachhochschule (FH) zusammenarbeiten. Das ermöglicht Masterstudenten an der FH, ihre Ausbildung mit einer Promotion abzuschließen. An EVision ist als dritter Partner die MedUni Wien beteiligt. Mit den FWF-Mitteln können die Personalkosten von fünf Doktoranden sowie ein Teil des Aufwands für Labormaterialien und Auslandsaufenthalte vier Jahre lang gedeckt werden. Vorgesehen sind drei- bis fünfmonatige Tätigkeiten der Doktoranden bei führenden Forschungsgruppen in Deutschland, Italien, Ungarn und Kanada. Das Programm beginnt mit Anfang des neuen Studienjahres im Oktober. Inhaltlich geht es bei EVision um die Rolle extrazellulärer Vesikel, die im Blut vorkommen, bei Entzündungsprozessen sowie bei der Blutgerinnung. Diese beiden Vorgänge sind laut Weber „immer sehr stark verbunden. Bei jeder Entzündung wird auch die Gerinnung aktiviert. So soll verhindert werden, dass sich eine Infektion weiter ausbreitet“. Allerdings kann die gleichzeitige Akti-vierung der Entzündung und der Gerinnung, bekannt als Immunothrombose, zu schweren Schädigungen des Organismus und schlimmstenfalls zum Tod führen. Der Grund ist Weber zufolge die Bildung kleinster Blutgerinnsel in den Kapillargefäßen, die den Blutfluss in die Organe behindert, diese schädigt und im Extremfall den Tod durch Multiorganversagen auslöst. Im Rahmen von EVision befassen sich die Doktoranden insbesondere mit Vesikeln, die in Blutprodukten enthalten sind. Während der Lagerung dieser Blutprodukte steigt die Anzahl der in ihnen vorhandenen Vesikel. Untersucht werden soll bei EVision unter anderem, ob diese Vesikel bei einer Verabreichung des Blutprodukts nachteilig wirken können. „Tumor-patienten etwa haben häufig schon eine voraktivierte Gerinnung. Verabreicht man ihnen ein Blutprodukt, das sehr viele Vesikel enthält, könnte das Effekte hervorrufen“, erläutert Weber. Deshalb sollten an Krebs Erkrankte eher mit frischen Blutprodukten behandelt werden. In Bezug auf Entzündungen wiederum deuten manche Studien darauf hin, dass Vesikel diese einerseits auslösen, andererseits aber auch eindämmen können. Auch mit diesen Phänomenen werden sich die Doktoranden im Zuge von EVision befassen.
Interaktion der Fachgesellschaften
Die breite Aufmerksamkeit, die das Thema „extrazelluläre Vesikel“ im Life-Science-Sektor findet, zeigt sich auch im Interagieren der ASEV mit der Österreichischen Gesellschaft für Molekulare Biowissenschaften und Biotechnologie (ÖGMBT). Laut Weber, die gemeinsam mit Andreas Spittler die ASEV gründete und derzeit der ÖGMBT präsidiert, waren bei Kongressen der ÖGMBT bereits mehrfach Vorträge und ganze Sessions dieser Thematik gewidmet. Ihr zufolge ziehen die beiden Gesellschaften an einem Strang, „einerseits, um junge Forschende für extrazelluläre Vesikel zu interessieren und andererseits in diesem Bereich tätige Personen sowie Institutionen noch besser zu vernetzen“. Die ÖGMBT hat laut Weber viele Firmenmitglieder und ist eine „sehr aktive Plattform für die Verbindung von Forschenden und Firmen“.
www.asev.at/annualmeeting
https://nvpm.lbg.ac.at
www.donau-uni.ac.at/de/universitaet
www.oegmbt.at
www.isev.org/isev2025
Published in Chemiereport 03/2024